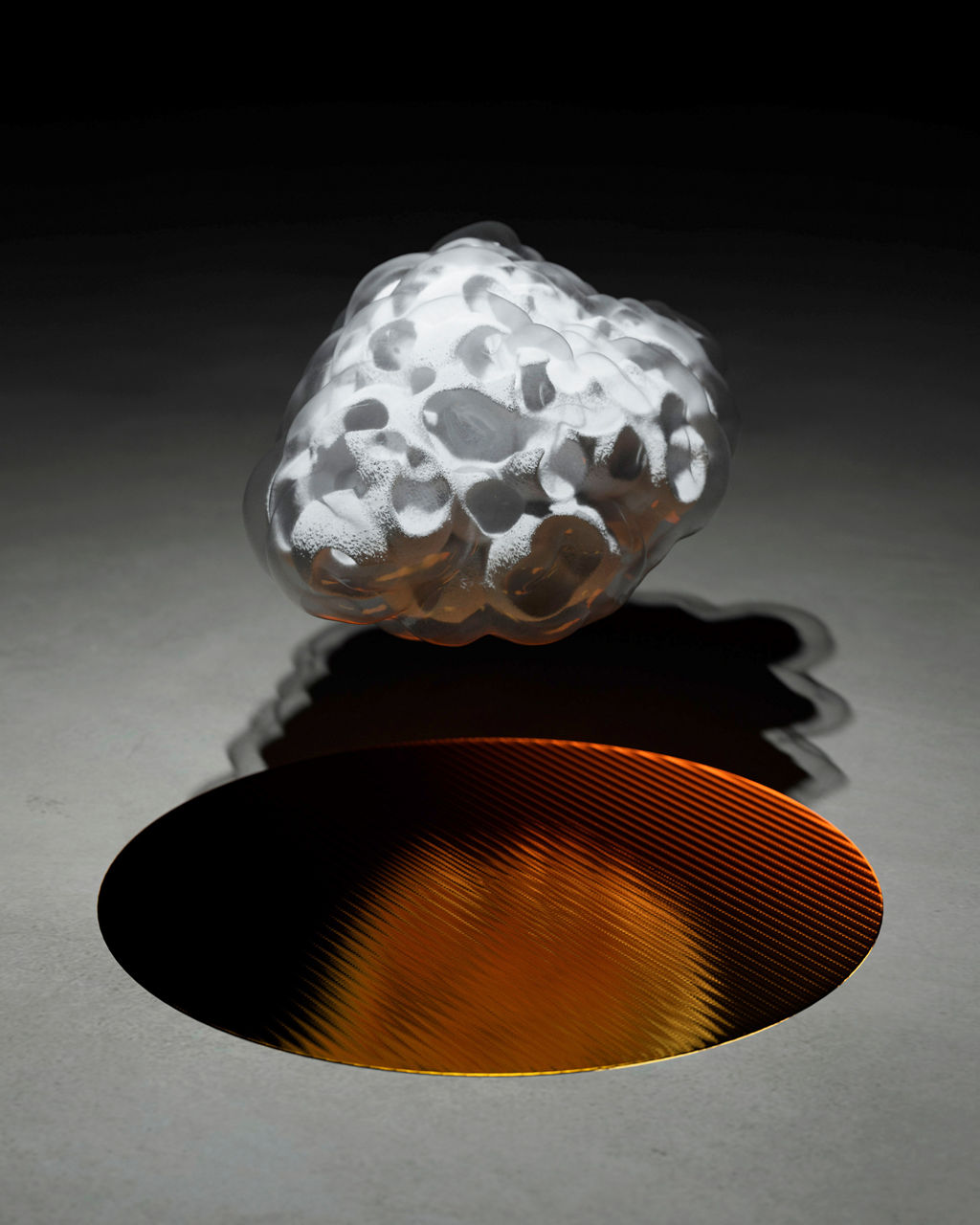Vertrauen schafft Zukunft
missing translation: fa.article-intro.reading-time – Interview: Bernd Zerelles – Artwork: Dean Giffin – Foto: Markus Rock – 05/01/2023
missing translation: fa.article-intro.reading-time – Interview: Bernd Zerelles – Artwork: Dean Giffin – Foto: Markus Rock – 05/01/2023
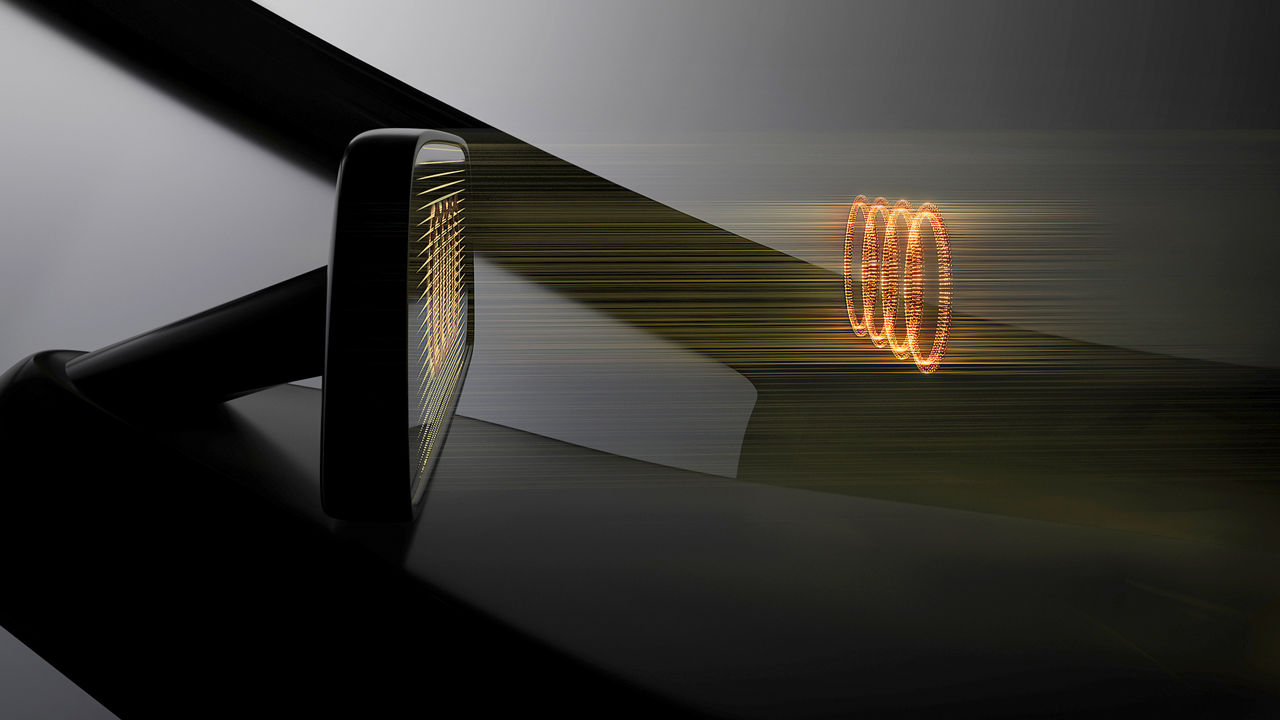
Herr de Haan, wie würden Sie Zukunft definieren? Ist sie von vergangenen Ereignissen bestimmt, oder ein Zeitraum voller offener Möglichkeiten?
Es ist immer beides. Wir sind im Grunde mit allem, was wir in der Vergangenheit realisiert haben und was wir gegenwärtig tun, schon in der Zukunft gelandet, weil die Folgen des Handelns in der Zukunft wirksam werden. Auf der anderen Seite ist nichts so festgelegt, dass man nicht mit Projektionen operieren und selber neue Ideen anstoßen könnte. Sonst müsste man ja sagen, es gibt Prognosen, durch die erkannt wird, wie die Zukunft aussehen wird. Dann könnten wir uns zurücklehnen und denken: Ich muss nicht aktiv werden, denn was die Zukunft bringt, tritt sowieso ein – sie ist festgelegt. Das ist sie aber nicht.
Sind in so unsicheren Zeiten wie jetzt Zukunftsforschende wie Sie besonders gefragt?
Wir nehmen das so wahr. Es ist ein deutliches Interesse an Antworten zu erkennen, die eben nicht auf die kurzfristige Bewältigung von Pandemien abzielen. Viel stärker als noch vor wenigen Jahren sind wir gefordert, innerhalb der Dynamik von gesellschaftlichen Veränderungen und dem hohen Grad an Innovationen, wie wir ihn heute erleben, neue oder veränderte Handlungsoptionen aufzuzeigen. Dabei versuchen wir immer partizipativ Ideen für die Zukunft zu generieren und diese Optionen wiederum in einen größeren Kontext zu stellen.
Sie analysieren gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Wie geschieht das?
Zukunftsforschung agiert nicht primär mit Prognostik, wie es bei der Erfassung statistischer Wahrscheinlichkeiten der Fall ist. Wir operieren mit dem, was man im alltagssprachlichen Sinne Wahrscheinlichkeiten nennt – wahrscheinliche Entwicklungen, die sich stark auf Plausibilitäten stützen. Wir versuchen, gute Gründe für bestimmte Entwicklungen zu finden, die sich einstellen könnten. So schauen wir auch nach dem, was man im Französischen die „longue durée“ nennt – Entwicklungen, die schon einen langen Zeitlauf haben. Auch daraus kann man eine Menge ableiten.
„Ästhetisierung ist ein universeller Trend. Wir laden Dinge und Ereignisse mit ganz persönlicher Bedeutung auf.

Nennen Sie bitte ein Beispiel zur Veranschaulichung.
Etwa der gesamte Prozess der Individualisierung, das Interesse daran, sich als einzelne Person artikulieren zu können oder auch eine eigene Lebensweise zu beschreiten, der uns schon seit dem vorletzten Jahrhundert begleitet. Ein Beispiel ist die Konstellation des Zusammenlebens: Vor 140 Jahren war man zwanghaft an Ehen gebunden. Heute reden wir eher von Lebensabschnittspartner_innen. Es existiert auch nicht mehr diese Festlegung auf die Bipolarität der Geschlechter. Das alles hat sich gewandelt und ist im Zuge von Individualisierungsprozessen ganz deutlich zu beschreiben. Dahinter liegen Interessen, die einen langen Anlaufprozess hatten, bis es eben zu dieser Wandlung gekommen ist.
Wie wandeln sich aktuell Gesellschaften weltweit? Und wodurch wird dieser Wandel getrieben?
Diese Individualisierungsinteressen sind weltweit zu erkennen – selbst in Ländern, die stark kollektivistisch ausgerichtet sind, wie China zum Beispiel. Darüber hinaus ist Ästhetisierung, also Formen der Selbstdarstellung, ein universeller Trend. Wir laden Dinge und Ereignisse mit ganz persönlicher Bedeutung auf. Ein Gegenstand, das Auto einer bestimmten Marke zum Beispiel, ist nicht mehr allein ein Statussymbol. Nein, es geht eher darum, dass man diesen Gegenstand braucht, weil man ihn selber für sich mit Bedeutung auflädt. Es zählt nicht, was das Produkt gekostet hat, sondern welchen Wert es für mich hat.
„Haltungen signalisieren die Erwartungen gegenüber der Zukunft in einer Gesellschaft.
Ist Zukunft ein Mindset, eine Haltung?
Ja, durchaus. Haltung ist ein neu entdecktes Wort, das die eigenen Normen, Werte, Gefühle und andere Einstellungen zusammenfasst. Haltungen signalisieren auch die Erwartungen in einer Gesellschaft gegenüber der Zukunft. Gerade im jüngeren Segment sehen wir auch Gruppen, die sich neue Lebensstile generieren, die ganz stark auf eine digitale Welt setzen und darin im Grunde ihren Lebensmittelpunkt sehen.
Wie gelingt es Gesellschaften, Zukünfte nachhaltig zu gestalten, Innovationen zu erzielen?
Noch vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, dass ein hohes Maß an Freiheit des Individuums und Liberalität Voraussetzungen dafür sind. Oder auch die Förderung von individueller Kreativität. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Man kann nicht mehr sagen, man braucht seine Freiheitsgrade, um im Sinne der Innovationsfähigkeit etwas selbst entwickeln und gestalten zu können. Die sogenannten 21st-Century-Skills, wie die Förderung von Kreativität oder Kritikfähigkeit, werden fast immer durch Initiativen auf Basis von neuen sozialen Gruppierungen vermittelt. Es sind also kollaborative Systeme, gemeinschaftliche Entwicklung und weniger Einzelaktivitäten, die zu Innovationen beitragen. Anders gesagt: Die kreative Intelligenz eines heterogenen Teams ist höher als die der einzelnen Mitglieder.

Verändern sich Gesellschaften eher behäbig?
Bezogen auf Haltung, sind die Entwicklungen alle langsam. Man kann das gut an der Verschiebung von Lebensstilen verfolgen. Viele dieser verschiedenen Varianten an Lebensstilen, die das klassische Denken in Schichtmodellen abgelöst haben, zeigen, dass solche Veränderungen nicht sehr schnellläufig sind.
Gibt es Faktoren, die Entwicklungen beschleunigen?
Es gibt natürlich auch ganz starke Treiber für Veränderungen. Disruptionen etwa, wenn neue Technologien eine ganz hohe Dynamik erfahren. Ich denke an Wearables, wenn unsere Kleidung mit der Kleidung anderer kommuniziert. Oder eine Erweiterung unserer Sinne, wo uns bei Begegnungen Informationen über andere eingespielt werden. Da entwickelt sich etwas völlig Neues. Die Frage ist dabei nicht, ob das von einer höheren Warte aus als sinnvoll erscheint oder nicht. Wichtig ist, dass diese Innovationen auf Resonanz stoßen. Im Idealfall heißt es dann aufseiten der möglichen Nutzer der Innovation: „Fantastisch! Ich wusste gar nicht, dass ich das unbedingt brauche.“
Sie sagten einmal, dass nach Krisen wie einer Pandemie die Menschen relativ schnell zu ihren alten Verhaltensmustern zurückkehren.
Das sehe ich in der Tat so. Habitualisierungen, also unsere Gewohnheiten, sind extrem stabil. Diese Erfahrung machen alle, die versuchen, sich zu verändern. Jedes Jahr Silvester sagt man sich, im neuen Jahr treibe ich mehr Sport. Aber wer hält das wie lange durch? Oder Menschen, die ihre Ernährung umstellen sollen: Die meisten halten das nicht durch. Man kehrt zu dem zurück, wie man sich immer bewegt oder ernährt hat. Denn das sind ganz starke Formen von Habitualisierung, an die wir uns sehr gewöhnt haben.
Die Angst vor Veränderungsprozessen ist zu groß, um aus Gewohnheiten nachhaltig auszubrechen?
Speziell in Deutschland sind die Ängste größer als in vielen anderen Ländern. Hier sagt man: Wenn wir die Folgen dessen, was wir da an Neuem sehen, nicht kennen, dann sollten wir es lassen. Es gibt andere Kulturen, die anders denken. Zum Beispiel herrscht in Brasilien, Großbritannien oder auch Vietnam die Haltung: Wenn wir nicht wissen, was die Folgen sind, dann können wir es ja wenigstens erst mal probieren.
Eine Zukunftswahrnehmung hängt also immer von mehr als der persönlichen Einschätzung ab?
So ist es. Dabei ist das Spektrum, wie Menschen auf die Zukunft blicken, breit gefächert. Die sogenannten Lebenserotiker sind Innovationen gegenüber sehr aufgeschlossen. Sie beurteilen die Zukunft danach, was für sie attraktiv ist. Diese Gruppe ist sehr freizeitorientiert, sehr dynamisch, immer auf der Suche nach neuen Ereignissen und neuen Gegenständen, mit denen man sich umgeben kann. Auf der anderen Seite steht das konservative Milieu. Aber wichtiger als diese Zuordnungen sind mittlerweile kleine kollaborative Systeme, die sich in den sozialen Medien zusammenschließen. Zwar gibt es auch innerhalb dieser Gruppierungen Meinungsmacher_innen. Doch entscheidend ist, dass man in diesen Gruppen das Gefühl hat, nicht völlig allein, sondern gemeinschaftlich auf einem Pfad unterwegs zu sein.
Veränderungen werden also in der eigenen Peergroup definiert?
Ja, diese ist von hoher Bedeutung. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für unsere Analysen in der Zukunftsforschung, ist Vertrauen. Wenn man sich mit Zukunftsfragen beschäftigt, ist die Frage immer: Wie bauen Menschen überhaupt Vertrauen auf in das, was da artikuliert wird? Ich bin Mitglied in der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Hier lautet die Frage an mich als Sozialwissenschaftler oftmals: Wie schaffen wir für die neuen Technologien Akzeptanz? Ich sage dann: Man muss erst schauen, dass man überhaupt eine Resonanz findet. Und zwar eine Resonanz, die auf Vertrauen basiert in das, was man an Innovationen entwickelt hat.
„Zukunft besteht im Grunde aus Projektionen.
Die Akzeptanz der Zukunft basiert also auf Vertrauen?
So würde ich das sehen, ja. Denn, was ist die Referenzgröße für Zukunft? Da ist keine Wirklichkeit, die wir uns anschauen können. Und in einer dynamischen Gesellschaft können wir mit den Erfahrungen aus unserer Geschichte die Erwartungen an die Zukunft auch nicht ohne Weiteres bewältigen. Zukunft besteht im Grunde aus Projektionen. Und für diese muss man beim Gegenüber um Vertrauen werben – sonst werden diese Projektionen nicht geglaubt, geschweige denn wirksam. Das gilt übrigens auch für Unternehmen. Sie müssen Vertrauen schaffen in die Ideen, die sie entwickeln.