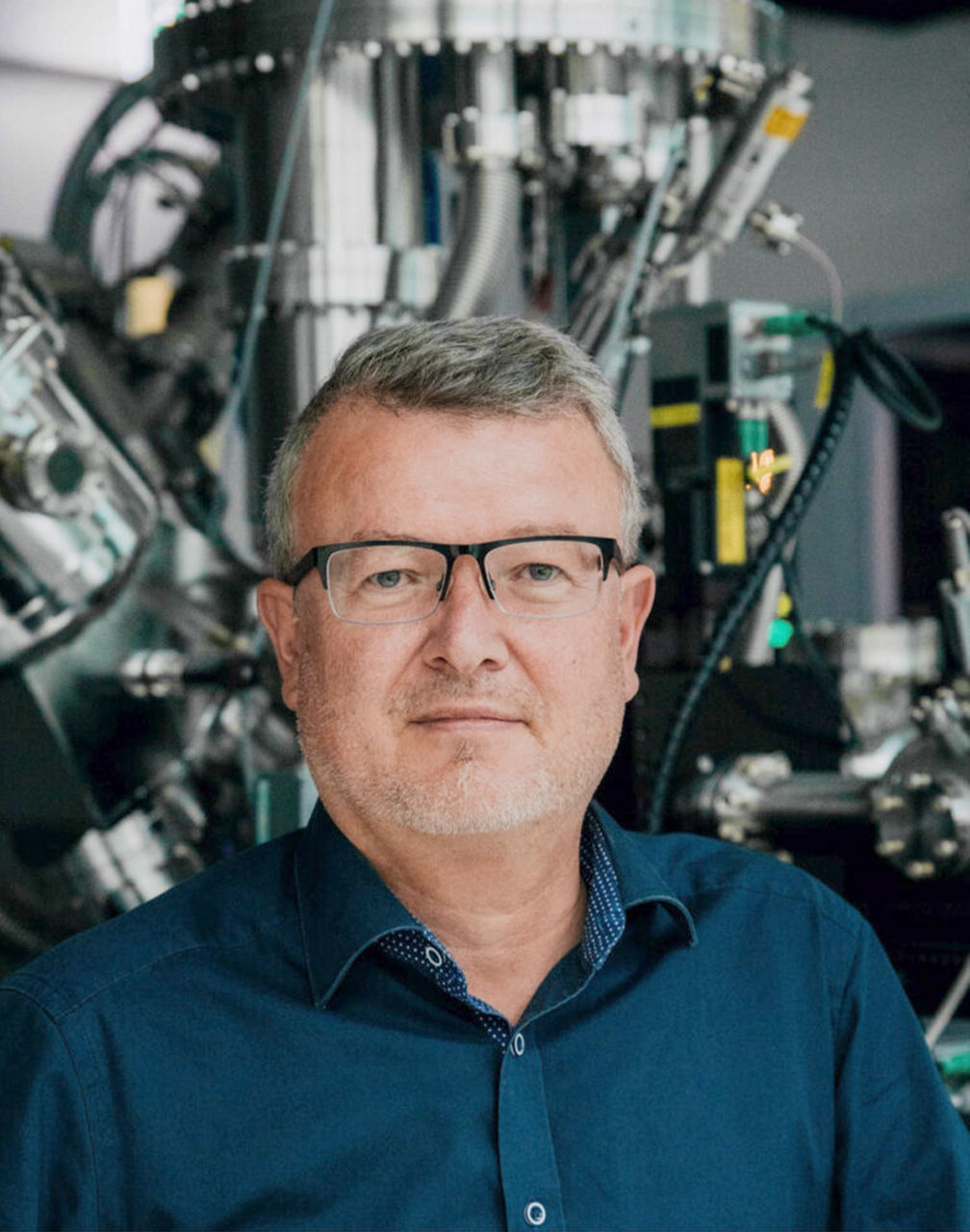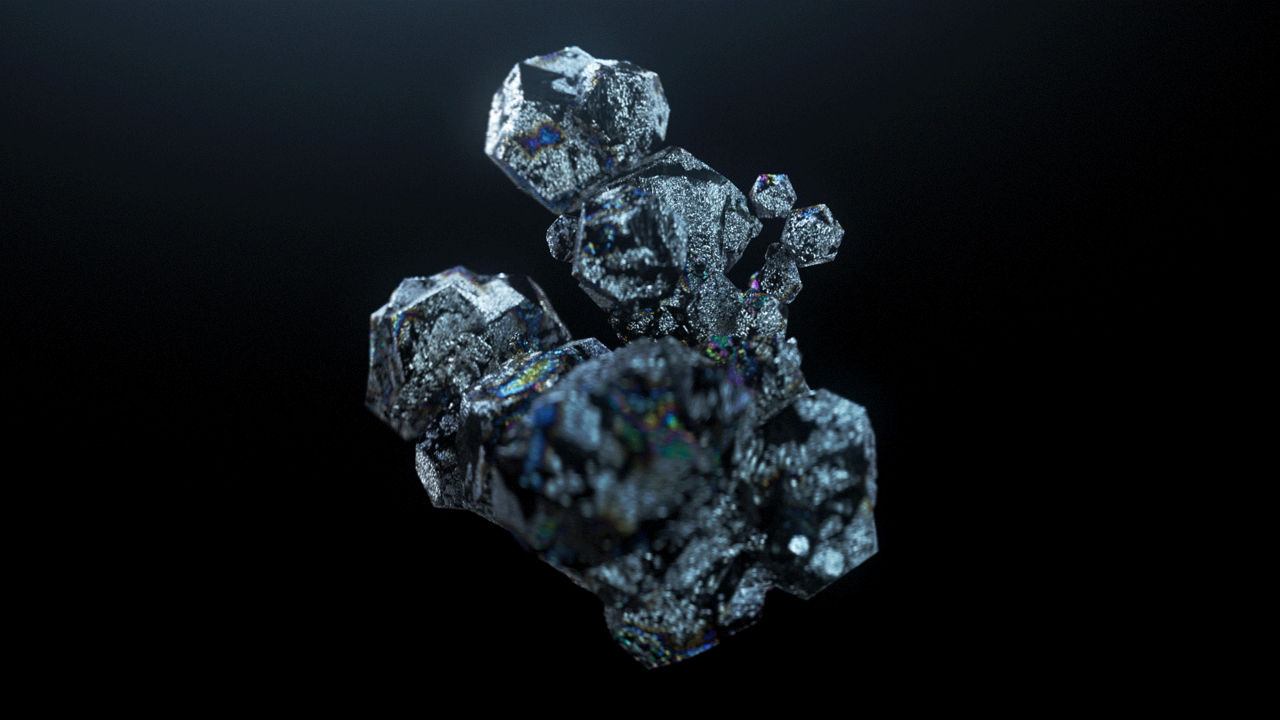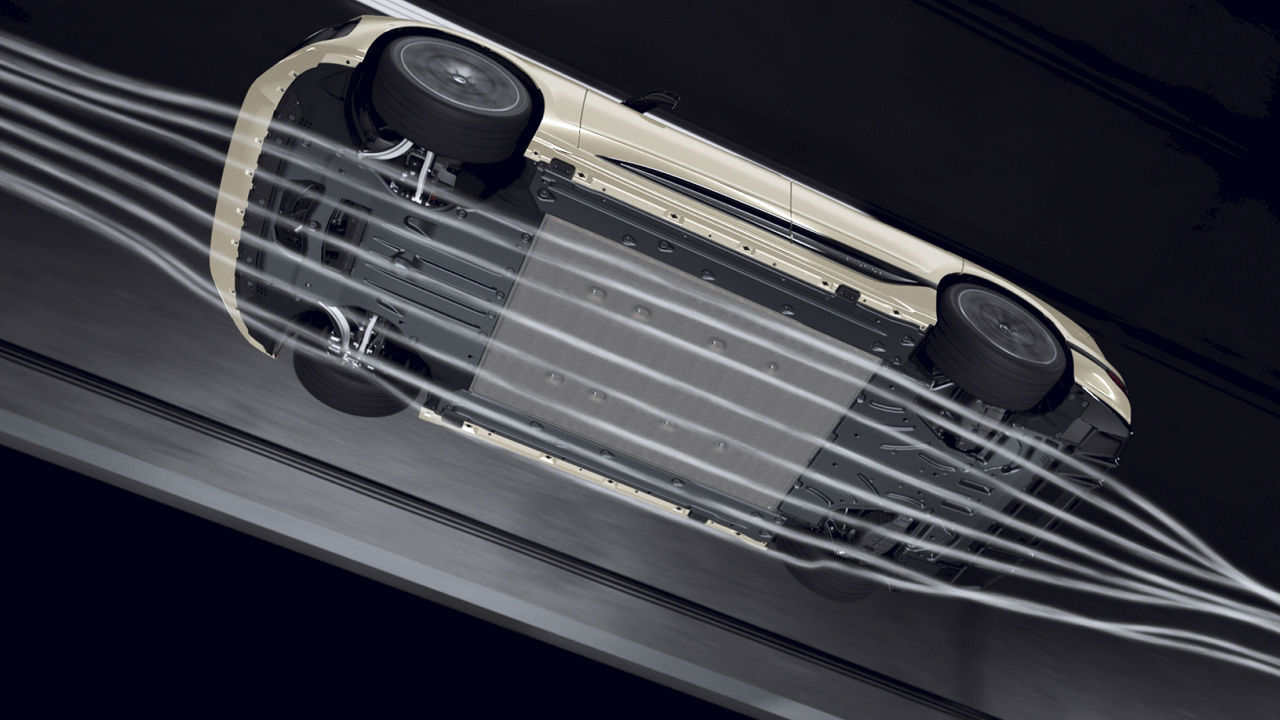Die Leistungsaufnahme wird ja häufig vernachlässigt. Wie ist der Zusammenhang zwischen Laden und Batterietechnologie?
Ja,
das stimmt, denn wann fährt man schon einmal 600 Kilometer am Stück?
Wichtig bei großen Batterien ist deshalb, dass sie die Möglichkeit
bieten, schnell zu laden. Das ist das eigentliche Argument. Wenn man den
Akku seines E-Fahrzeugs in zehn Minuten von zehn auf 80 Prozent lädt,
nimmt das dem Verbrennungsmotor jedes Argument. Es gibt Materialien, die
lassen sich schneller beladen, und solche, die sich langsamer beladen
lassen. Technisch gesehen verschieben sich die Lithium-Ionen in der
Batterie beim Laden vom Pluspol zum Minuspol, dort müssen sie sozusagen
hineinkrabbeln, sich einlagern.
Im Augenblick verwendet man am
Minuspol eine Graphit-Schichtstruktur. Es gibt schon Batteriehersteller,
die hier Silizium-Kohlenstoff-Komposite einsetzen wollen. Diese sind
deutlich schneller beladbar, auch bei tiefen Temperaturen. Da ist
materialseitig viel Entwicklungspotenzial. Allein durch diese
Materialänderung am Minuspol erhält die Gesamtzelle 30 Prozent mehr
Speicherkapazität. Da sind noch unglaublich große Entwicklungssprünge
möglich. Abgesehen davon: Wenn Sie eine 60-kWh-Batterie in zehn Minuten
laden wollen, benötigen Sie einen Ladeanschluss mit 360 kW Leistung. Das
zeigt, dass die Limitierung zurzeit immer weniger auf Batterieseite
liegt, als vielmehr bei der Ladeinfrastruktur.
Bei
einem Smartphone lässt bei häufiger Nutzung die Leistungsfähigkeit der
Batterie nach zwei, drei Jahren deutlich nach. Wie lange ist die
Lebensdauer einer Batterie eines Elektrofahrzeugs?
Die
Batterie im Smartphone ist ganz anders gestrickt und darauf konzipiert,
dass Sie das Smartphone nach drei Jahren erneuern. Im Auto ist die
Batteriesteuerung viel intelligenter, und die Batterie wird auf
vielerlei Art und Weise, zum Beispiel durch intelligentes
Lademanagement, vor Überhitzung und anderen schädlichen Einflüssen
geschützt. Untersuchungen mit neueren Fahrzeugen zeigen, dass nach fünf
Jahren in der Regel noch 95 Prozent Restkapazität der Batterie zur
Verfügung stehen. Die Traktionsbatterie in einem Elektrofahrzeug ist so
ausgelegt, dass sie 2000 Vollzyklen absolvieren kann. Als Beispiel: 2000
mal 500 Kilometer Reichweite macht eine Million Kilometer. Nach diesen
2000 Vollzyklen erreicht die Batterie eine Schwelle von 80 Prozent
Restkapazität, was als Kriterium für das Lebensende der Batterie gilt.
Die Batterie ist dann aber noch lange nicht kaputt und kann zum Beispiel
in einem Stationärspeicher von Photovoltaik- oder Windkraftanlagen noch
zehn Jahre gute Dienste tun.